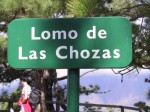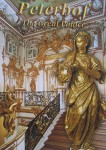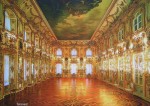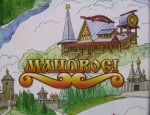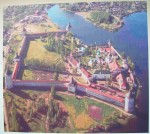Freitag, 6. Juni 2008
Vienne
Stadtrundfahrt Lyon
Lichterfahrt Lyon
Heute Morgen legen wir in Vienne an und um 8.30 Uhr startet von hier aus unsere Stadtrundfahrt durch Lyon. Unsere heutige örtliche Reiseleiterin läßt es sich nicht nehmen, uns ausführlich über Vienne zu berichten, dass es sich um die Hauptstadt des keltischen Allobroger Stamms handelte und dass während der Herrschaft von Augustus (31 v.Chr. bis 14 n.Chr.) die Wichtigkeit dieser Siedlung durch den Bau einer Verteidigungsmauer und den Tempel von Augustus und Livia betont wurde. Dieser Tempel soll das am besten erhaltene romanische Gebäude Frankreichs sein. Da jedoch noch nicht einmal ein Stopp hier gemacht und nichts besichtigt wird, möchte ich auch gar nicht weiter auf die tolle Stadt Vienne eingehen.
Mit Lyon verhält es sich da schon anders. Mit ca. 1,35 Mio. Einwohnern ist sie die zweitgrößte Stadt Frankreichs und hat eine stolze Geschichte die sich über 2000 Jahre erstreckt. Die Stadt wurde 43 vor Christus als Lugdunum von den Römern gegründet und wurde später die Hauptstadt Galliens. Obwohl Lyon sich bereits im Mittelalter großer Bedeutung rühmte, erreichte es erst im 16.-17. Jh. seinen absoluten Höhpunkt als es sich auf den Bereich der Seidenspinnerei und auf das Druckereiwesen spezialisierte.
Auf dem Weg zu unserm ersten Stopp, oben auf dem Hügel Fourviére, fahren wir an dem römischen
Theater vorbei, wo wir die Vorbereitungen für ein am Wochenende stattfindendes Spektakel betrachten
können. Oben angekommen haben wir – unter Regenschirmen hervor – einen guten Überblick über die
 Stadt zwischen Rhone und Saone mit ihren vielen Brücken und können uns schon einmal an den herausragenden Gebäuden etwas orientieren.
Stadt zwischen Rhone und Saone mit ihren vielen Brücken und können uns schon einmal an den herausragenden Gebäuden etwas orientieren.
Wir sehen den Place Bellecour, der mit einer Fläche von 319 m mal 20 m einer der größten in Frankreich ist. Hier gibt es auch ein Verkehrsbüro, in dem ich mir am Samstag Informationen holte. Die Besonderheit: ein großes Touristenbüro und niemand spricht deutsch und englisch sehr eingeschränkt!
Wir sehen auf Cathedrale St. Jean, die im 12. bis 15. Jh. erbaut wurde und wir ebenfalls am Tag unserer Ankunft das Glück hatten, davor einen mittelalterlichen Markt und den Auszug der Kommunionkinder zu erleben.
Weiter werden wir auf den Platz vor dem Rathaus aufmerksam gemacht, daneben befindet sich das
Museum „Beaux-Arts“ und dahinter ragt der moderne Aufsatz des Opernhauses auf.
Zu Entstehung der Basilika Notare Dame de Fourvière, die 1872-96 errichtet wurde, ist zu berichten: 1870 erbitten die Lyoner und ihr Erzischof die Fürsprache der Jungfrau, um zu verhindern, dass die preußischen Armeen in die Stadt eindringen. Diese Bitte wird erhört und als Dank beschließt man den Bau der Basilika.
 Hiervon gibt es mehrere Besonderheiten zu berichten: Sie ist eine Kirche, die nur Maria geweiht ist. Man wird – lt. Reiseführerin – kein einziges Kreuz darin finden. Es ist eine private Kirche, die nicht der „Kirche“ gehört und auch heute noch von Privatleuten, bzw. einem großen Chemiekonzern in Stand gehalten wird. Kann man sagen, es ist eine „stillose“ Kirche, da sich byzantinische, romanische und gotische Elemente
Hiervon gibt es mehrere Besonderheiten zu berichten: Sie ist eine Kirche, die nur Maria geweiht ist. Man wird – lt. Reiseführerin – kein einziges Kreuz darin finden. Es ist eine private Kirche, die nicht der „Kirche“ gehört und auch heute noch von Privatleuten, bzw. einem großen Chemiekonzern in Stand gehalten wird. Kann man sagen, es ist eine „stillose“ Kirche, da sich byzantinische, romanische und gotische Elemente
vermischen? Boden- und Wandmosaiken – zwei dieser großen Mosaike, auf der Linken Seite der Kampf der Christen gegen die Türken und auf der rechten Seite der Einzug von Jean d’Arc – erklärt uns unsere Reiseleiterin. Vielfarbiges Fensterglas, bunter Marmor, Holzschnitzereien, Stuck, Säulen und Säulchen. Wie heißt es so schön: „Es gibt tatsächlich kein Fleckchen, das zu zieren man vergessen hätte.“
Wir freuen uns schon auf den Bummel durch die pittoreske Altstadt. Wir werden am Saone-Ufer vor dem Justizpalast aus dem Bus entlassen und spazieren in das Alt-Lyon „Vieux Lyon“. Wir betrachten pittoreske  Gebäude, kommen in Innenhöfe, in die wir uns am Samstag alleine nicht hineingetraut hätten, da wir annahmen, das ist privat. Und wir „trabulieren“. Das will heißen, dass die zahlreichen Quergassen, „Traboules“ genannt, vom Lateinischen: „trans ambulare“ = hindurchgehen , eine echte Besonderheit der Altstadt von Lyon ist.
Gebäude, kommen in Innenhöfe, in die wir uns am Samstag alleine nicht hineingetraut hätten, da wir annahmen, das ist privat. Und wir „trabulieren“. Das will heißen, dass die zahlreichen Quergassen, „Traboules“ genannt, vom Lateinischen: „trans ambulare“ = hindurchgehen , eine echte Besonderheit der Altstadt von Lyon ist.
In Ermangelung von ausreichend Platz für ein Straßennetz wurden Dutzende dieser quer zur Saone verlaufenden Gassen angelegt, die durch spitzbogige Gänge mit vielen Gebäuden, Innenhöfen und Galerien im Renaissancestil führen. So „trabulierender-weise“ gelangen wir wieder zum Bus, um die Stadtrundfahrt fortzusetzen.
Wir fahren wieder über die Saone und an ihrem anderen Ufer – mit den „Verkaufskisten“ der Buchhändler vorbei – retour. Betrachten unterwegs die Illusionsmalerei an den diversen Häusern, fahren an der Markthalle vorbei und steigen am Place des Terreaux aus, um gleich
vorbei – retour. Betrachten unterwegs die Illusionsmalerei an den diversen Häusern, fahren an der Markthalle vorbei und steigen am Place des Terreaux aus, um gleich  neben dem Rathaus die Werkstätte einer Seidenweberei zu besichtigen. Wir bekommen demonstriert wie die Seide bemalt wird und im oberen Stockwerk die Entstehung von Schals in Pannesamt und Seide – doppelt gewebt – entsteht.
neben dem Rathaus die Werkstätte einer Seidenweberei zu besichtigen. Wir bekommen demonstriert wie die Seide bemalt wird und im oberen Stockwerk die Entstehung von Schals in Pannesamt und Seide – doppelt gewebt – entsteht.
Wir haben danach noch etwas Gelegenheit einen Blickzu werfen auf den Bartholdi Springbrunnen, der eigentlich 1887 für die Stadt Bordeaux geschaffen wurde und die Garonne mit ihren Nebenflüssen darstellt. Bordeaux weigerte sich, ihn zu kaufen. Das Modell wurde auf der Weltausstellung 1889 gezeigt und von Dr. Gailleton, dem damaligen Bürgermeister, bemerkt und erworben, zu einem Gelegenheitspreis.
Springbrunnen, der eigentlich 1887 für die Stadt Bordeaux geschaffen wurde und die Garonne mit ihren Nebenflüssen darstellt. Bordeaux weigerte sich, ihn zu kaufen. Das Modell wurde auf der Weltausstellung 1889 gezeigt und von Dr. Gailleton, dem damaligen Bürgermeister, bemerkt und erworben, zu einem Gelegenheitspreis.
 Ein paar Schritte weiter kann man den schönen ehemaligen Klostergarten vom Palast St. Pierre betrachten. Hier ist das Museum der Schönen Künste untergebracht.
Ein paar Schritte weiter kann man den schönen ehemaligen Klostergarten vom Palast St. Pierre betrachten. Hier ist das Museum der Schönen Künste untergebracht.
Von hier aus geht es direkt zum Schiff retour.
Den Nachmittag verbringt mein lieber Mann lesend auf dem Schiff und ich wandere in ca. 20 Minuten nochmal zurück in die pittoreske Altstadt, um auch einmal einen Bummel durch einige der
hübschen Geschäftchen zu machen. T-Shirts für die Enkelkinder und für mich einen Schal, das ist das Ergebnis des Streifzuges. Zudem entdecke ich noch einige hübsche Innenhöfe.
Abends um 21.30 Uhr findet die Lichterfahrt statt.
Vom Veranstaltungsleiter werden wir darauf aufmerksam gemacht, doch Badelaken und die Wolldecke aus der Kabine mitzunehmen, da es auf dem offenen Doppeldeckerbus doch recht frisch werden könnte.
Wir sind 16 Personen, die sich das mit großer Erwartung antun, da Lyon auch als Stadt der Illumination betitelt wird und 200 Denkmäler, Sehenswürdigkeiten und Brücken indirekt angestrahl werden.
Im Grunde genommen ist die Rundfahrt identisch mit der Tagestour. Zuerst hoch zur Basilika
Notre-Dame-de-Fourviére. Zwanzig Minuten haben wir Zeit, die beleuchtete Stadt von oben zu
betrachten. Zugegeben: etwas enttäuschend. Vielleicht liegt es aber auch an uns, da wir Moskau bei Nacht noch in guter Erinnerung haben und davon begeistert waren.
Ja, mehr muss ich darüber gar nicht berichten, da wir die Sehenswürdigkeiten, die wir bereits tagsüber bei der Rundfahrt gesehen haben, nun illuminiert sehen.
Nach 1 1/2 Stunden kommen wir total durchgefroren wieder an Schiff an. Eine heiße Dusche soll die
Lebensgeister wieder wecken.